Ab Januar 2017 verschärft das „Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum“ die Regelungen für das Qualitäts-Siegel „ Swiss Made “. Hatte sich der Begriff bislang hauptsächlich auf die Herkunft des Uhrwerks bezogen, so gelten die Vorgaben ab Januar 2017 für die gesamte Uhr.
Konkret heißt das:
- Künftig müssen für eine Uhr als Ganzes (Endprodukt) – jedoch ohne Armband oder Kette – mindestens 60 Prozent der gesamten Wertschöpfung in der Schweiz anfallen – anders als bisher, wo die Forderungen sich einzig auf das Uhrwerk bezogen haben. Bei den Herstellkosten dürfen nunmehr jedoch auch die Abschreibungen für die anteiligen Entwicklungskosten eingerechnet werden.
- Das Uhrwerk bleibt aber in seiner Bedeutung ganz vorne dabei. So muss mindestens die Hälfte seines Wertes aus Bestandteilen Schweizerischer Fabrikation bestehen und mindestens 60 Prozent der gesamten Herstellungskosten müssen in der Schweiz anfallen.
- Die technische Entwicklung sowie der Bau von Prototypen einer «Swiss Made»-Uhr sowie eines «Swiss Made»-Uhrwerks müssen künftig ebenso in der Schweiz erfolgen.
- Damit im Zuge der aktuellen technologischen Entwicklungen auch die sog. «Smartwatches» von der «Swiss Made»-Verordnung für Uhren erfasst werden, wird der Begriff „Uhr“ entsprechend weiter gefasst.
Die Fragen, die sich nun stellen, lauten wie folgt:
- Welches sind die gravierenden Unterschiede zur bisherigen Regelung?
- Welche Bedeutung bzw. Konsequenz haben die Änderungen für die Hersteller?
- Welchen Nutzen zieht letztlich der Kunde daraus?
Bevor wir uns den drei Fragen zuwenden, sehen wir uns den Begriff „Swiss Made“ nochmals etwas genauer an und befragen dazu Wikipedia. Dort steht zu lesen:
Definition:
Der Begriff Swiss Made stellt eine Herkunftsauszeichnung für Schweizer Produkte dar, ähnlich anderen Herkunftsbezeichnungen wie beispielsweise „Made in Germany“. Die Kennzeichnung soll Verbrauchern auch als Qualitätssiegel dienen. Begriffe wie Made in Switzerland, Fabriqué en Suisse oder Hergestellt in der Schweiz hätten als Kennzeichnung auf Zifferblätter von Uhren aufgrund der Länge und Leerzeichen zu Problemen führen können. Daher erlaubt das Schweizer Gesetz auch die Bezeichnungen Suisse, produit suisse, fabriqué en Suisse, qualité suisse oder Übersetzungen wie Swiss oder eben Swiss Made. Der Begriff findet sich auf vielen Schweizer Uhren wieder, in der Regel auf dem Zifferblatt bei der 6.
Aber was erhält der Kunde, wenn er im Jahr 2016, also noch vor der Novellierung der neuen Richtlinie in einem Fachhandel eine sog. „Swiss Made“ Uhr erwirbt?
Die aktuelle, bis Ende 2016 noch gültige Mindestvorgabe lautet
Eine Uhr ist dann als Schweizer Uhr (Swiss Made) anzusehen, wenn:
- ihr Werk schweizerisch ist;
- ihr Werk in der Schweiz eingeschalt wird und
- der Hersteller ihre Endkontrolle in der Schweiz durchführt.
Ein Uhrwerk ist als Schweizerisch anzusehen, wenn:
- es in der Schweiz zusammengesetzt wird;
- es durch den Hersteller in der Schweiz kontrolliert wird und
- die Bestandteile aus schweizerischer Fabrikation, ohne Berücksichtigung der Kosten für das Zusammensetzen, (also die reinen Materialkosten) mindestens 50 Prozent des Wertes ausmachen.
D.h. bei Uhren aus aktueller Produktion gibt es keine Vorgaben hinsichtlich der Herkunft von Bändern, Gehäusen, Zifferblättern und Zeigern. Lediglich das Uhrwerk muss der „Swiss Made“ Regelung genügen und die Uhr muss in der Schweiz montiert und geprüft werden.
Werden also Band, Gehäuse, Gläser, Zifferblatt und Zeiger beispielsweise von außerhalb der Schweiz bezogen, so stellt dies keinen Mangel dar, solange eben alles in der Schweiz montiert und ein Schweizer Uhrwerk eingeschalt wird. Mit der bisherigen Regelung, zahlreiche Komponenten – ausgenommen das Uhrwerk – auch von außerhalb der Schweiz beziehen zu können, war den Herstellern die Möglichkeit gegeben, sich bei günstigeren Lieferanten und Standorten umzusehen und so bezahlbare „Swiss Made“ Uhren auch im Einstiegssegment zu realisieren.

Im Bild: Das STP 1-11 in der Ausführung mit gebläuten Schrauben.
Ob die bestehende „Swiss Made“ Regelung für den Endkunden nun ausreichend erscheint oder nicht, ist schwer auszumachen. Für die Qualität des Endproduktes ist vielmehr entscheidend, wo und von wem das Produkt entwickelt wird, also beispielsweise festgelegt wird, welche Materialien zu verwenden sind und in welchen Toleranzen und Güten die Einzelteile zu fertigen und zu liefern sind. Wer das macht, wie und wo das zu geschehen hat, legt der verantwortliche Entwickler und Auftraggeber – also meist der Uhrenhersteller – fest.
Bei der späteren Montage aller Einzelteile zu einer fertigen Uhr in den Ateliers der Uhrenhersteller werden dann alle Komponenten zusammengefügt und zuvor auf die Einhaltung der vereinbarten Qualitätsmerkmale überprüft. Dafür haftet und garantiert der Hersteller heute schon.
Mit dieser Regelung sind Hersteller und Kunden über mehrere Jahrzehnte gut zurecht gekommen. Swiss Made ist und war ein Qualitätsbegriff.
Die Auswirkungen der neuen Regelung
Was gab denn nun den Anstoß, die bestehende Reglung zu ändern, wenn angeblich alle zufrieden waren? Der Kunde gab den Anstoß wohl kaum, da dieser die zuvor beschriebenen Feinheiten in der Regel ohnehin weder kennt, noch im Detail kennen möchte.
Wenn ein Kunde sich beispielsweise eine TISSOT kauft, so trägt diese das Qualitätssiegel „Swiss Made“. Kauft er sich stattdessen eine Rolex oder Patek Philippe, so tragen diese ebenfalls dieses Siegel und kaum jemand macht sich Gedanken, was da im Hintergrund evtl. anders läuft und wer woher welche Teile bezieht.

Im Bild: Tissot: Le Locle Regulateur
Nun wird es vermutlich so sein, dass die Premium-Manufakturen – allein der Begriff steht schon für eine hohe hauseigene Wertschöpfung (Vertikalisierung) – die meisten Teile entweder selbst fertigen oder dazu Lieferanten in ihrer unmittelbaren Umgebung in der Schweiz unter Vertrag haben, die nicht nur allerhöchsten Qualitätsansprüchen genügen, sondern auch technologisch ganz vorne mitspielen. Die vom Kunden abverlangten hohen Preise machen dies möglich aber auch nötig.
Bei Uhren im Einsteigersegment sieht die Welt natürlich anders aus. Hier muss jeder Cent bzw. Rappen dreimal umgedreht werden, denn es heißt Zielkosten einzuhalten, soll die Uhr hinterher im Handel wettbewerbsfähig und dennoch kostendeckend angeboten werden können. Für solche Modelle ist der Hersteller häufig gezwungen, sich nach Lieferanten im kostengünstigeren Ausland umzusehen, zumal der starke Franken Anreize schafft, günstig im Ausland einzukaufen.
Ob das nun Zeiger aus Frankreich oder Gehäuse aus Deutschland bzw. gar Fernost sind, spielt eigentlich keine Rolle. Die in Fernost heute eingesetzten Werkzeugmaschinen sind in aller Regel aus Schweizer, deutscher oder japanischer Produktion und entsprechen damit exakt dem, was hierzulande ebenfalls State of the Art ist. D.h. die Teile, die an z.T. fernen Standorten auf solchen Maschinen gefertigt werden, sind in ihrer Qualität nicht von jenen zu unterscheiden, die in der Schweiz gefertigt werden, vorausgesetzt, die strengen Qualitätsvorgaben werden auch peinlichts eingehalten. Dafür aber steht der Uhrenhersteller in der Verantwortung dieses zu gewährleisten und kann so den erwirtschafteten Kostenvorteil an den Endkunden weitergeben.
Das iPhone von Apple wird bei einem großen Elektronik-Zulieferer in Fernost gefertigt und trägt als Herkunftsbezeichnung „Made in China“. Die Geräte sind aber anerkanntermaßen von höchster Qualität und begeistern die Käufer immer wieder auf´s Neue. Anderer Ware aus China haftet hingegen noch häufig das Billigimage an.
Was sagt uns das?
Letztlich ist für den Verkaufserfolg nicht primär die Herkunftsbezeichnung „Made in …. “ ausschlaggebend, sondern der Markenname, der dahinter steht. So gehen Automobilhersteller in der Premiumklasse immer mehr dazu über, nicht mehr „Made in ….“ zu verwenden, sondern vielmehr „Made by …..“ Ob der bestellte BMW oder Mercedes nun in Deutschland (Made in Germany) oder in USA (Made in USA) oder sonst wo gefertigt wird, soll den Kunden nicht länger beschäftigen oder gar verunsichern. So nach dem Motto: „Hilfe mein BMW ist gar nicht „Made in Germany“, sondern „Made in USA“. Ist der damit jetzt schlechter?“ Solche oder ähnliche Fragen stellen sich nicht, wenn das Produkt stattdessen mit „Made by BMW“ versehen wird. So hat der Kunde die Sicherheit und Gewissheit, dass alle Fahrzeuge dieses Herstellers – und zwar unabhängig aus welchem Werk und aus welchem Land sie kommen – echte BMW´s sind und ohne Wenn und Aber denselben Qualitätskriterien genügen.
Mit der neuen „Swiss Made“ Regelung 2017 verhält es sich aber gänzlich anders. Hier zählt tatsächlich primär die Herkunftsbezeichnung, die für den Kunden im Zeitalter der Digitalisierung und Globalisierung aber eigentlich immer unwichtiger wird.
Was lernen wir daraus?
Es scheint also vielmehr so zu sein, dass die Väter der neuen „Swiss Made“ Regelung weniger den Endkunden im Fokus hatten, als vielmehr versuchen mit einer Rolle rückwärts, in schon fast protektionistischer Manier, den Standort Schweiz für die Produktion von Uhren abzusichern und abzuschirmen, indem der zu erbringende Wertschöpfungsanteil nicht nur auf > 60% erhöht wurde, sondern sich statt auf das Uhrwerk künftig nun auf den Wert der gesamten Uhr (ohne Armband) bezieht. Die Hersteller – speziell in der Einstiegspreisklasse – werden gezwungen sein, auch kostenintensive Komponenten, wie Gehäuse und Gläser oder aufwendige Zifferblätter, nicht mehr ohne weiteres im kostengünstigeren Ausland, sondern im Hochlohnland Schweiz zu produzieren und einzukaufen. Da helfen dann selbst erstklassige Zulieferungen aus Deutschland oder dem nahen Frankreich nicht. Beide Standorte sind eben nicht „Swiss Made“.
Die Kosten für die fertigen „Swiss Made“ Uhren werden sich ab 2017 – zumindest in der Einstiegspreisklasse – damit einmal mehr nach oben bewegen. Die Hersteller haben zumindest ein Argument mehr, es zu tun. Der Nutzen für den Kunden? Vermutlich gar keiner! Die Uhren werden dadurch weder besser noch ganggenauer, noch haltbarer, oder wertstabiler als bisher, sie werden tendenziell wieder einmal nur teurer.
Die Bereitschaft des Kunden ab 2017 für eine „Swiss Made“ Uhr künftig mehr Geld zu bezahlen als für ein mit dem Prädikat „Swiss Made 2016“ versehenes identisches Modell, können wir allerdings nicht erkennen.
Für die Hersteller der Oberklassemodelle ändert sich in einer ersten Näherung hingegen nicht viel. Hier ist der Kostendruck auf die Einzelteile bedeutend geringer und damit die Möglichkeiten, die neuen Vorgaben ohne Preiserhöhungen umzusetzen, ungleich größer, wenngleich der ein oder andere vielleicht dennoch versucht sein könnte, auch daraus wieder Kapital zu schlagen.

Im Bild: Patek Philippe, Jahreskalender-Chronograph
Schlussfolgerung
Bei der Festlegung dieser neuen Bestimmungen wurde einmal mehr die Rechnung ohne den Wirt, oder sagen wir besser, ohne den Kunden gemacht. Die Schweizer Uhrenindustrie erweist sich u.E. damit einen Bärendienst. Die Umsätze und Erträge sind seit rund 2 Jahren rückläufig und zwar gerade auch in der unteren Preisklasse der Einsteiger und Quarz-Modelle. Und wir wagen zu behaupten, dass den Kunden in diesem Segment die Bezeichnung „Swiss Made“ zumindest mittelfrsitig betrachtet weniger wichtig sein wird. Hier sorgen vermehrt neue Anbieter von multifunktionalen intelligenten Uhren für völlig neue Herkunftsbezeichnungen, ohne dass dies den Kunden bislang stören oder gar vom Kauf abhalten würde.
Und wenn ein Schweizer Hersteller, unter Einhaltung der bisherigen Vorgaben, seine Uhr bislang so gerade eben noch mit dem Prädikat „Swiss Made“ versehen konnte, so muss er dies – passt er die Wertschöpfungskette nicht entsprechend an – künftig entfallen lassen. Nur dann kann er die Fertigung des Uhrwerk und die gesamte Endmontage auch gleich komplett nach Fernost verlagern. Hilft das dann dem Standort Schweiz in irgendeiner Weise? Wohl kaum. Der Schuss könnte also nach hinten losgehen.
Wie lautet Ihre Meinung dazu?
LINKS:
Der Autor:
Herr Dipl.-Ing. (FH) Patrick Weigert ist als Geschäftsführer einer Unternehmensberatungsgesellschaft u.a. für die Automobil- und Luxusgüterindustrie tätig und beobachtet und analysiert als Mitbegründer und Gesellschafter beim Deutschen Uhrenportal die Entwicklungen und Trends auf dem Sektor für hochwertige Uhren und neue Technologien.
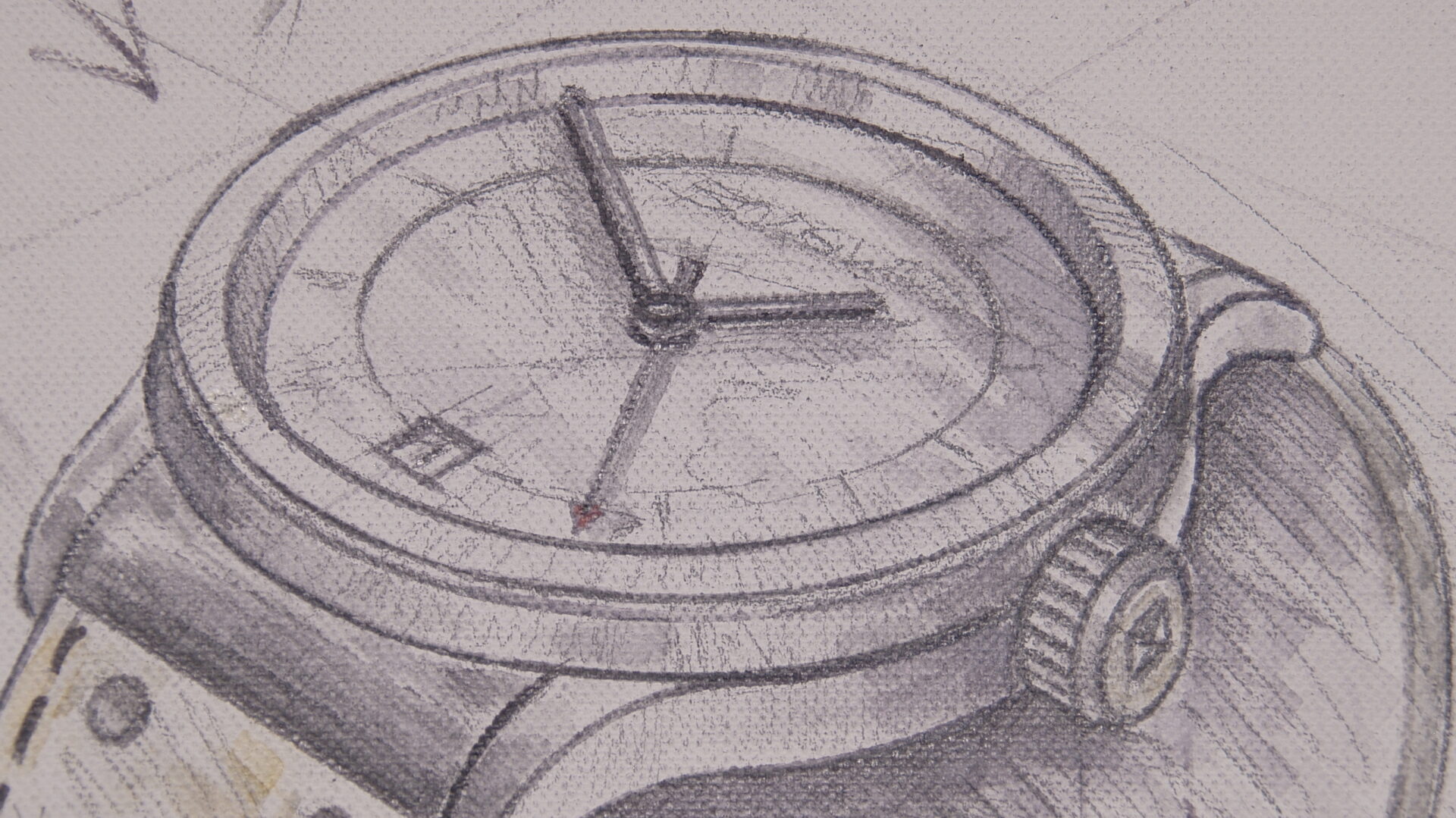
Ich glaube die Wertschöpfung bezieht sich auf die unbebänderte Uhr. D.h. diese könnten weiterhin im Ausland bezogen werden
Es ist tatsächlich so. Das Armband gilt nicht als Bestandteil der Uhr. Insofern kann dessen Bezug unabhängig der neuen Swiss Made Vorgaben erfolgen.
Pingback: Das Uhrenjahr 2017 und seine vielfältigen Perspektiven - Uhren-Blog über Design und Technik
Pingback: Der Salon EPHJ-EPMT-SMT 2017 in Genf, die wichtigsten Eindrücke - Uhren-Blog über Design und Technik