Nachdem sich der Markt von Smartwatches mit Modellen unterschiedlichster Bauart zügig weiter ausdehnt und einzelne Hersteller dabei auch vermehrt mit integrierten Funktionen zur Überwachung und Erfassung von Sport- und Fitnessparametern werben, stellt sich für den interessierten Käufer die Frage, ob diese vollelektronischen Uhren bzw. Wearables für den zuverlässigen Einsatz unter diesen erschwerten Bedingungen auch die erforderliche Dichtigkeit aufweisen.
Selbst bei Sportarten, die nicht notwendigerweise im oder am Wasser stattfinden, werden erhöhte Anforderungen an die Dichtigkeit gestellt. Die Einflüsse reichen von Schweißabsonderung der Haut über Regenwasser – bei Sportarten unter freiem Himmel und Schlechtwetterbedingungen – bis hin zu Händewaschen und Duschen.
Eine ganz andere Klasse der Beanspruchung stellen Sportarten dar, die direkt am oder im Wasser stattfinden. Je nachdem, ob z.B. beim Segeln oder Surfen mit Spritz- und ggfs. sogar Strahlwasser zu rechnen ist, kommen beim Schwimmen und Tauchen dann noch Belastungen hinzu, die über das zuvor beschriebene noch deutlich hinausgehen.
Wer die Dichtigkeitsklassifizierungen von klassischen Armbanduhren kennt, weiß, dass diese Beanspruchungen unterschiedlichster Art durch eine entsprechende Ausführung der Gehäuse heute gut beherrscht und durch die in der DIN 8310 bzw. ISO 22810 hinterlegten Prüfanforderungen abgesichert werden.
Selbst eine umgangssprachlich als „wasserdicht“ bezeichnete Armbanduhr ist nie völlig dicht, das heißt vollständig gegen Wassereindrang geschützt. Der Massefluss in die Uhr muss für definierte Prüfbedingungen jedoch unterhalb des festgelegten Wertes von 50µg/min (vgl. DIN 8310) liegen. Für den Alltag bedeutet dies nichts anderes, dass Wasser – in geringster Menge versteht sich – in die Uhr eindringen kann, z.B. wenn sie für sehr lange Zeit im Wasser liegt oder stark erhöhtem Wasserdruck ausgesetzt wird. So können einfache Uhren sehr wohl spritzwasserdicht sein, das heißt, sie überstehen eine Wasserbeaufschlagung für einige Sekunden unbeschadet, wie dies z.B. beim Händewaschen der Fall ist. Längeres Untertauchen würde jedoch zu Schäden führen.
Bei aufwendiger abgedichteten Modellen wird deshalb angegeben, für welchen Druck und welche Dauer diese ausgelegt sind. Hierbei ist aber stets zu beachten, dass durch mehr oder weniger starke Bewegungen im Wasser (z.B. beim Schwimmen oder gar Springen ins Wasser) der auf die Uhr einwirkende Druck stark ansteigt.
Die Einteilung von Uhren nach DIN 8310 ist wie folgt festgelegt:
Dabei gilt zu beachten, dass die Meter-Angabe sich nicht auf eine bestimmte Tauchtiefe, sondern auf den Prüfdruck bezieht, welcher im Rahmen der Wasserdichtigkeitsprüfung zur Anwendung kommt.
Bei Schwimmbewegungen oder unter einem Wasserstrahl (z.B. beim Duschen oder Springen ins Wasser) können Druckspitzen entstehen, die die Uhr deutlich stärker belasten, als es die bloße Angabe der Eintauchtiefe vermuten lässt. Erst ab der Klassifizierung von 5 bar kann daher von einer tatsächlich wasserdichten Uhr gesprochen werden, mit der z.B. das Duschen möglich ist. Ab der Klassifizierung 10 bar kann die Uhr problemlos beim Schwimmen und Schnorcheln eingesetzt werden. Erst ab einer geprüften Wasserdichtigkeit von 20 bar kann die Uhr auch zum Tauchen verwendet werden.
Wasserdichtigkeit ist zudem keine bleibende Eigenschaft. Die im Gehäuse integrierten Dichtelemente können altern und damit im täglichen Gebrauch in ihrer Funktion nachlassen. Daher empfiehlt sich die Überprüfung der Dichtungen und Dichtigkeit alle ein bis zwei Jahre.
Wenn eine Uhr zusätzlich großen Temperaturunterschieden ausgesetzt wird, etwa bei einem Sonnenbad mit anschließendem Sprung ins kühle Nass, kann sich im Gehäuse Kondensat bilden, das zum Beschlagen des Uhrglases auf seiner Innenseite führen kann. Dies muss zwar nicht zwangsläufig eine Undichtigkeit bedeuten, die Feuchtigkeit muss aber zur Vermeidung von Folgeschäden unbedingt sofort durch einen Fachmann entfernt werden.
Wird die Uhr gar zum Schwimmen oder Tauchen in Meerwasser eingesetzt, so ist die durch das im Wasser gelöste Salz verursachte Korrosion zu beachten. Nach jedem Aufenthalt in Salzwasser ist das sorgfältige Spülen mit Süßwasser somit obligatorisch.
Kommen wir nach diesem ausführlichen Exkurs zurück zur Smartwatch. Was wird dort aktuell angeboten? Nun, Bezeichnungen oder Klassifizierungen, wie sie sich bei klassischen Uhren bewährt haben, sucht der Interessent fast immer vergebens. Häufig wird stattdessen mit sogenannten IP-Klassifizierungen geworben. Z.B. wasserdicht nach IP 67.
Was hat es damit auf sich und was bedeutet das? Bei der IP Klassifizierung handelt es sich um sogenannte Schutzarten (International Protection Code) nach DIN 40050, die ihren Ursprung in der Elektrotechnik haben und Auskunft darüber geben, unter welchen Bedingungen ein elektrotechnisches Gerät eingesetzt werden kann und darf. Hier steht zunächst die Sicherheit für Leib und Leben im Vordergrund und schließt die Betriebssicherheit des Gerätes unter vorgegebenen Bedingungen mit ein.
Wenn eine Lampe z.B. an der Außenwand eines Gebäudes befestigt werden soll und damit dauerhaft der Witterung ausgesetzt wird, muss sie anderen Anforderungen genügen, als dies beim Betrieb im Inneren eines Gebäudes der Fall wäre. Auch im Automobilbau spielt die IP-Klassifizierung eine große Rolle. Steuergeräte oder Funktionseinheiten, die im Inneren eines Fahrzeugs verbaut sind, müssen nicht denselben Anforderungen standhalten, wie beim Einsatz im Außenbereich des Fahrzeugs.
Was schließen wir daraus? Eine Übereinstimmung mit Duschen, Schwimmen, ins Wasser springen oder gar Tauchen, wie bei klassischen Armbanduhren, ist bei den IP-Klassifizierungen nicht gegeben. Erst bei einer Klassifizierung von mindestens IP69 kann von einer Eignung für den Betrieb im und am Wasser gesprochen werden. Die erste Ziffer (in diesem Fall „6“) gibt dabei die Staubdichtigkeit an, die zweite (in diesem Fall „9“) die Widerstandsfähigkeit gegen starkes Strahlwasser, wie dies z.B. beim Hochdruckreinigen von Straßenfahrzeugen der Fall ist.
Auch die Apple Watch ist nach IP klassifiziert. Im konkreten Fall aber nur nach IPX7. Was bedeutet das? Die erste Ziffer, welche die Schutzklasse gegen das Eindringen von Fremdkörpern, wie z.B. Staub angeben soll, wird ausgespart, d.h. nicht angegeben, daher das „X“. Eigentlich verwunderlich, wenn schon nach International Protection Code klassifiziert wird. Die zweite Ziffer, im konkreten Fall „7“, bedeutet dicht gegen zeitweiliges Untertauchen, und zwar lediglich in 1m Wassertiefe für 30 min. Das hat mit Schwimmen oder Springen ins Wasser oder gar Tauchen, mit den erhöhten Druckanforderungen – siehe die Ausführungen weiter oben – nicht im Geringsten etwas zu tun.
Leider folgt nun auch TAG Heuer diesem völlig unverständlichen Trend. Die nun wirklich nicht gerade kostengünstige TAG Heuer Connected mit IP67 zu spezifizieren, mutet schon ziemlich eigenartig an. Was möchte TAG Heuer dem Kunden damit sagen und wie soll der Fachhändler dem Kunden die Verwendungsmöglichkeiten, oder sagen wir besser, die damit verbundenen Einschränkungen, vermitteln?
Eine derart spezifizierte Smartwatch als Gerät zur Erfassung von Sport- und Fitnessaktivitäten einzusetzen, wird auf Dauer kaum problemlos funktionieren.
Wenn dann gar noch Apps wie Swim.com geladen und installiert werden und die Smartwatch durch den Nutzer auch im Wasser genutzt und betrieben wird, dann sind die zu erwartenden Probleme eigentlich schon vorprogrammiert. Auch ist völlig unklar, wie z.B. bei einer Apple Watch die Wartung und ggfs. Erneuerung der Gehäusedichtungen vonstatten gehen soll. Haben die Apple Stores Dichtigkeitsprüfgeräte, wie jeder gute Uhrmacher, um damit dem Kunden nach einer gewissen Gebrauchsdauer die Gewissheit der spezifizierten Dichtigkeit zu geben? Wohl kaum!
Die zusätzlichen Schwachstellen bei Smartwatches gegenüber konventionellen Uhren sind beispielsweise zusätzliche Gehäuseöffnungen für den Anschluss von Ladekabeln sowie jene für Mikrofon und Lautsprecher, sofern Sprachein- und -ausgabe möglich sein sollen. Bei der Apple Watch sind zwar durch das induktive Laden des Akkus keine elektrischen Kontakte nach außen geführt, dafür aber eine Öffnung für Mikrofon und Lautsprecher.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuell auf dem Markt angebotenen Smartwatches und Wearables dringend nach den gültigen Vorgaben der DIN 8310 bzw. ISO 22810 zu qualifizieren sind. Nur dann sind zuverlässige Angaben hinsichtlich der Gebrauchstüchtigkeit in Verbindung mit dem Element Wasser möglich und der Kunde kann dann, verglichen mit seiner konventionellen Armbanduhr, auch eine entsprechende Funktionstüchtigkeit erwarten und beim Hersteller ggfs. reklamieren, sollte sein gutes Stück bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dennoch Undichtigkeiten zeigen.
Hier besteht akuter Handlungsbedarf und zeigt sehr deutlich, dass die hauptsächlich aus dem Bereich der Elektronik stammenden Anbieter von Smartwatches und Wearables hinsichtlich der Gebrauchstüchtigkeit ihrer Produkte im Alltag noch ganz deutlichen Nachholbedarf haben. Wenn nun auch die traditionellen Uhrensteller dem Beispiel von TAG Heuer folgen, dann ist die Verwirrung garantiert. Die traditionellen Uhrenhersteller haben in diesem Punkt die Nase doch eigentlich ganz weit vorne und dieses Know-How sollte nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden.
Sollten die Hersteller nicht selbst darauf kommen, nachzubessern, so ist es die Aufgabe der einschlägigen Fachmagazine bei der Beurteilung der Smartwatches künftig verstärkt darauf achten, dieses Thema in ihren Tests zu reklamieren und so den Druck auf die Anbieter wirksam zu erhöhen, damit die Vergleichbarkeit mit den konventionellen Armbanduhren gewährleistet bleibt.
Der Autor:
Herr Dipl.-Ing. (FH) Patrick Weigert ist als Geschäftsführer einer Unternehmensberatungsgesellschaft für die Automobilindustrie und ihre Zulieferer tätig und beobachtet und analysiert als Mitbegründer und Gesellschafter beim Deutschen Uhrenportal auch die Entwicklungen auf dem Sektor für hochwertige mechanische und smarte Uhren.
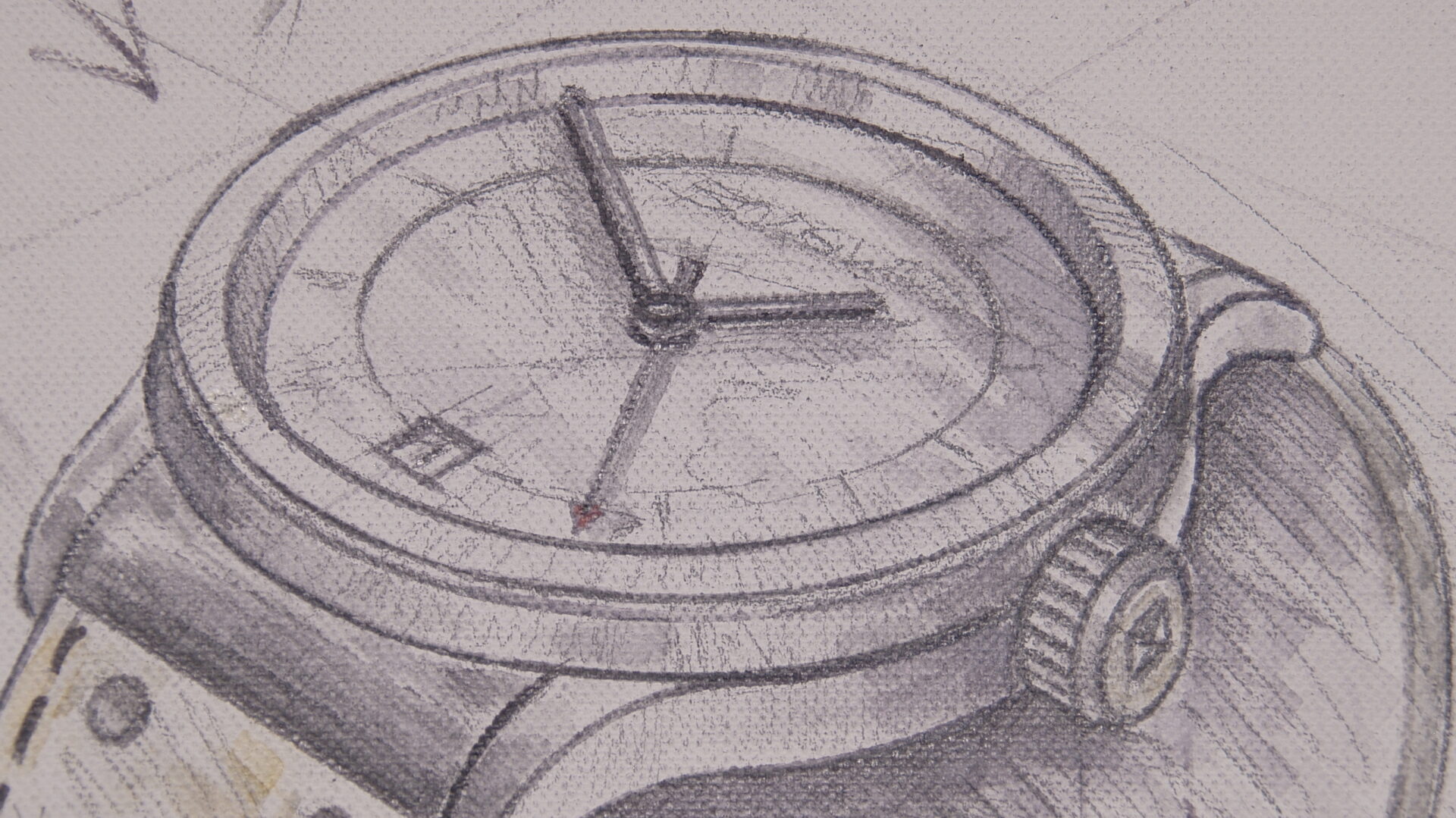

Pingback: Smartwatches und Wearables, eine Gegenüberstellung der verschiedenen Konzepte | Uhren-Blog über Design und Technik